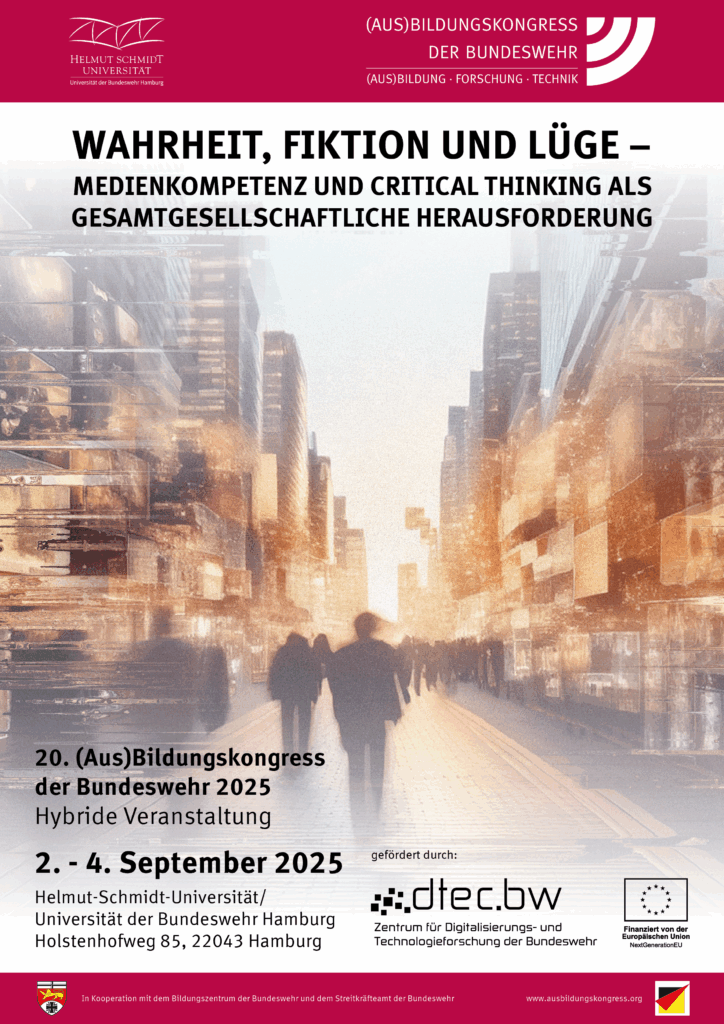PRESSEMITTEILUNG
Hamburg, 8.8.2025
Die Jahrestagung der Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung (GfeW) findet vom 10. bis 12. September 2025 an der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg statt.
Krisen und Konflikte gehören zu den drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Vom Krieg in der Ukraine, in Gaza und im Sudan bis hin zu globalen Krisen wie der Erderwärmung, Extremwetter und wachsender gesellschaftlicher Polarisierung durch soziale Medien und Rechtsextremismus: Der gesellschaftliche Konsens bröckelt – alte und neue Konflikte brechen auf. Die experimentelle Wirtschaftsforschung untersucht diese Phänomene nicht nur theoretisch, sondern unter kontrollierten Bedingungen im Labor: Sie testet, wie Emotionen wie Rache, Missgunst, Diskriminierung oder Gruppendenken das Verhalten von Menschen in Konfliktsituationen beeinflussen – und welche Mechanismen zur Deeskalation beitragen können. ,,Wir bringen Theorien aus dem Elfenbeinturm ins Labor, wo sie sich dem Realitätscheck stellen“, sagt Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff, Vorsitzender der GfeW. Seit bald 50 Jahren liefert die Gesellschaft mit ihren Mitgliedern neue Erkenntnisse über das menschliche Verhalten in Krisen – oft mit überraschenden Ergebnissen.
Konflikte unter der Lupe der Verhaltensökonomie
Rund 100 internationale Forscherinnen und Forscher werden vom 10. bis 12. September den aktuellen Stand der experimentellen Wirtschaftsforschung diskutieren. Über 70 Vorträge befassen sich mit klassischen Forschungsthemen und greifen zugleich das diesjährige Kernthema auf: ,,Krisen und Konflikte: Perspektiven der experimentellen Wirtschaftsforschung“. Die experimentelle Wirtschaftsforschung ist aufgrund ihres methodischen Instrumentariums besonders geeignet, um solche Herausforderungen zu analysieren“, sagt Prof. Dr. Stefan Traub, lokaler Organisator der Jahrestagung und Inhaber der Professur für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Behavioral Economics, an der HSU. ,,Sie hat unser Verständnis politischer Konflikte – von Handelskriegen bis zu militärischen Auseinandersetzungen und globalen Krisen wie dem Klimawandel – maßgeblich vorangebracht.“
Zwei profilierte Stimmen aus der Konfliktforschung
Mit Prof. Dr. Dr. Lydia Mechtenberg und Dr. Dr. Hannes Rusch wurden zwei international profilierte Expertinnen und Experten eingeladen, die in ihren Plenarvorträgen zentrale Perspektiven zum Kernthema einbringen werden.
Lydia Mechtenberg ist Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Politische Ökonomie, an der Universität Hamburg. Sie ist Sprecherin der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsgruppe „Big Structural Change“. In ihrer Arbeit untersucht sie, wie äußere Einflüsse wie Klimawandel, Globalisierung oder Massenmigration tiefgreifende Veränderungen in der sozialen Struktur eines Landes auslösen können – und welchen Einfluss dabei die von der Bevölkerung empfundene Legitimität von Institutionen hat. Der Titel ihres Plenarvortrags lautet: ,,Umgang mit Konflikten und Krisen – eine experimentelle Perspektive“.
Hannes Rusch leitet die Forschungsgruppe „Behavioral Economics of Crime and Conflict“ am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Er ist außerdem assoziierter Professor an der Universität Maastricht. Mit seinem Team untersucht er, wie gesellschaftliche Interessenkonflikte entschärft werden können, bevor sie in Trennung, Unterdrückung, Gewalt oder Krieg eskalieren. In seinem Plenarvortrag wird Rusch der Frage nachgehen: ,,Wie kann die experimentelle Ökonomie zur Konfliktforschung beitragen?“
+++ Für Redaktionen +++
Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, die Tagung der Gesellschaft für Experimentelle Wirtschaftsforschung vom 10. bis 12. September 2025 an der Helmut Schmidt-Universität in Hamburg zu begleiten. Eine Teilnahme an allen Vorträgen sowie insbesondere den beiden Plenarvorträgen ist möglich. Hierzu ist eine Akkreditierung erforderlich. Für akkreditierte Medienvertreterinnen und -vertreter besteht darüber hinaus die Möglichkeit, individuelle Gespräche mit ausgewählten Referentinnen und Referenten zu führen. Akkreditierungen und Presseanfragen richten Sie bitte an:
Prof. Dr. Stefan Traub
Volkswirtschaftslehre, insb. Behavioral Economics
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
Holstenhofweg 85
22043 Hamburg, Germany
[email protected]
+49 (0)162 100 2421
Deadline: Freitag, 5. September 2025
Weitere Informationen finden Sie unter:
Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg
Die Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU/UniBw Hamburg) wurde 1972 gegründet und dient der akademischen Ausbildung von Offizieranwärterinnen, Offizieranwärtern und Offizieren der Bundeswehr. Benannt nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, verbindet sie exzellente Lehre mit praxisnaher Forschung. Die Universität bietet Studiengänge in Ingenieurwissenschaften, Wirtschafts-, Sozial- und Geisteswissenschaften an. Ein besonderes Merkmal ist das Trimester-System, das einen schnelleren Studienabschluss ermöglicht. Neben sicherheits- und verteidigungspolitischen Themen setzt die HSU auf Forschung in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technologie. Sie pflegt enge Kooperationen mit internationalen Hochschulen und der Wirtschaft. Die Studierenden stehen in einem Dienstverhältnis zur Bundeswehr, während die Universität auch zivilen Studierenden offensteht. Als wissenschaftliche Einrichtung mit militärischer Prägung bereitet sie Führungskräfte auf anspruchsvolle Aufgaben in Bundeswehr, Verwaltung und Industrie vor.
www.hsu-hh.de