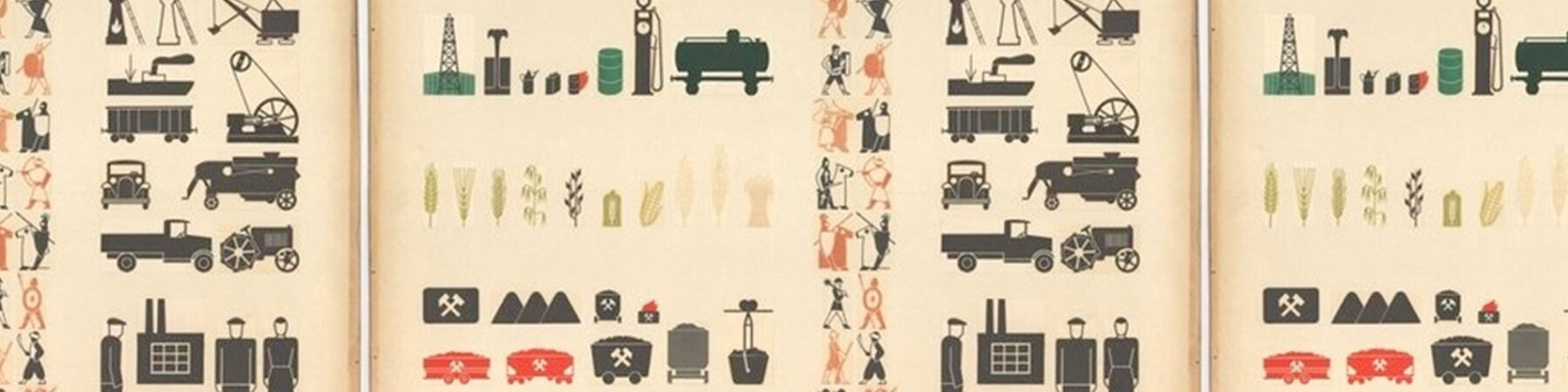Kontakt

Fakultät für Geistes und
Sozialwissenschaften
Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte
Postfach 70 08 22
22008 Hamburg
CV
seit 04/2018 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
Professur für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte
05/2010 – 11/2017 Promotion
Ruhr-Universität Bochum
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte
07/2015 – 01/2017 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
Professur für Neuere Sozial-, Wirtschafts- und Technikgeschichte
05/2012 – 07/2012 Stipendiatin
TU Darmstadt
DFG-Graduiertenkolleg 1343 Topologie der Technik
05/2010 – 04/2014 Stipendiatin
Fritz Thyssen Stiftung
Projekt: Europäische Montanregionen im Zeitalter der Industrialisierung im Vergleich
02/2007 – 8/2007 Auslandssemester
Universidade de Lisboa (Lissabon)
Faculdade de Letras
06/2006 – 11/2009 Studentische Hilfskraft
TU Berlin
Lehrstuhl für Technikgeschichte
04/2004 – 11/2009 Magisterstudium
TU Berlin / Humboldt Universität Berlin
Wissenschafts- und Technikgeschichte (Hauptfach)
Neuere deutsche Philologie (Nebenfach)
Neuere und Neueste Geschichte (Nebenfach)
Konferenzen
Organisation und Planung:
05/2017 Kohle, Wasser, Wind: Wissen und Praxis in technisierten Umwelten
Sektion auf der 26. Jahrestagung der GTG
Braunschweig
04/2016 4. Technikhistorisches Forum der GTG
Düsseldorf
05/2015 Nachwuchsworkshop der GTG
Berlin
08/2013 Sites of Resource Extraction (mit Sebastian Haumann)
Sektion auf der 7th Conference of the European Society
of Economic History (ESEH)
München
11/2011 Industrialisation in European Regions (mit Juliane Czierpka, Kathrin Oerters)
Konferenz an der Ruhr-Universität Bochum
Vorträge (Auswahl)
05/2017 Von der Grube bis zur Halde. Eine Energielandschaft der Steinkohle
26. Jahrestagung der GTG
Braunschweig
07/2016 Every grain of black coal. A material perspective on sustainability.
43. Annual Meeting of ICOHTEC
Porto
03/2015 Jenseits der Idylle. Landschaften zwischen Energie und Bild (mit Nicole Hesse)
Technospaces. Persistence – Practices –Procedures – Powers
Darmstadt
06/2014 Schwarzes Gold. Kleinreviere im deutschen Steinkohlenbergbau in der
Industrialisierung
Technikhistorisches Forum der GTG
Stuttgart
08/2013 From the underground into an industrial setting: The interrelations of coal
fields and the environment at Germany’s periphery
7th Conference of the European Society of Economic History
München
11/2012 Spatial patterns of coal. Small mining districts in
times of industrialisation
2nd Mining in European History Conference
Innsbruck
Publikationen und Vorträge
Veröffentlichungen
Herausgeberschaft:
Rohstoffräume/Sites of Resource Extraction. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1/2016. (mit Sebastian Haumann)
Regions, Industries and Heritage. Perspectives on economy, society and culture in modern Western Europe (Palgrave Studies in the History of Social Movements), Basingkstoke u.a.: Palgrave Macmillan 2015. (mit Juliane Czierpka und Kathrin Oerters)
Aufsätze:
Rohstoffräume. Räumliche Relationen und das Wirtschaften mit Rohstoffen, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1/2016. S.1-7. (mit Sebastian Haumann)
Vom Rohstoff zum Produkt. Wirtschaftliche und technische Verflechtungen von Steinkohlen im Inde- und Wurmrevier, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1/2016. S.115-142.
Regions, Industries, and Heritage. Perspectives on Economy, Society, and Culture in Modern Western Europe, in: Czierpka/Oerters/Thorade: Regions, Industries and Heritage. Perspectives on economy, society and culture in modern Western Europe. Basingkstoke u.a.: Palgrave Macmillan 2015, S. 1-8. (mit Juliane Czierpka und Kathrin Oerters)
Coal, transport and industrial development. The impact of coal mining in Lower Silesia, in: Czierpka/Oerters/Thorade: Regions, Industries and Heritage. Perspectives on economy, society and culture in modern Western Europe. Basingkstoke u.a.: Palgrave Macmillan 2015, S. 71-87.
Produzieren, Herstellen, Fabrizieren: Neue historische Perspektiven auf die Produktionstechnik. Konferenzbericht der 23. Jahrestagung der Gesellschaft für Technikgeschichte, in: Technikgeschichte 4/2014. (mit Nicole Hesse)
Kleinreviere im Steinkohlenbergbau. Die sächsischen Reviere Zwickau und Lugau-Oelsnitz (Fachexposé für die Landesstelle Industriekultur in Sachsen), Berlin/Halle 2012.
Rezensionen:
Kleinschmidt, Christian; Volk, Otto (Hrsg.): Industriekultur an Lahn und Dill (Beiträge zur hessischen Wirtschaftsgeschichte 8), Darmstadt: 2013, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 65, 2016, S. 164-166.
Thomes, Paul; Quadflieg, Peter M. (Hrsg.): Unternehmer in der Region Aachen – zwischen Maas und Rhein, (Rheinisch Westfälische Wirtschafts-Biographien 19). Aschendorff, Münster 2015, in: Der Anschnitt. Zeitschrift für Montangeschichte 70, 1-2 2018, S. 96-98.
Projekte
DFG Projekt: DFG-Projekt: Laufzeit: 01.04.2018 – 31.03.2022
Die Informatisierung und Computerisierung der Produktionstechnischen Forschung in der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Das Forschungsprojekt „Die Informatisierung und Computerisierung der Produktionstechnischen Forschung in der Bundesrepublik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ widmet sich den Ideen und Konzepten von Fabrik und industrieller Arbeit, die nach 1945 in der universitären und außeruniversitären Forschung in Deutschland entwickelt wurden. Im Mittelpunkt steht die Produktionstechnische Forschung (PTF) und damit die Forschungen und Entwicklungen zur zukünftigen Produktionstechnik, zu Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen und Arbeitsformen in den Fabriken.
Indem die Forschungsprojekte, Leitbilder, Entwürfe und Konzepte der PTF analysiert werden, soll ein Beitrag zur Geschichte der Technikwissenschaften in der Bundesrepublik geleistet werden, die für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bisher wenig erforscht wurde. Die Untersuchung der Informatisierung und Computerisierung der PTF zielt hierbei nicht auf die Nutzung des Computers für oder in Forschungstätigkeiten der PTF selbst ab, sondern stellt neue Ansätze und Forschungen, die die zukünftige Produktionstechnik als rechnerintegriert oder -gestützt und als informationstechnisches System konzipierten, in den Mittelpunkt. Es geht damit auch darum, einen Beitrag zu einer Geschichte der Computerisierung zu leisten, in der bislang Themen wie die Bedeutung der PTF für die Computerisierung und Informatisierung der industriellen Arbeitswelt noch keine Aufmerksamkeit erfuhren.
Die von der produktionstechnischen Forschung entwickelten Konzepte wurden nicht deterministisch in den Fabriken umgesetzt, lösten aber durchaus vielfältige Diskussionen aus – sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch in der Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stand nicht zuletzt die Frage nach der Zukunft der Arbeit und der Ersetzung der Menschen durch die Maschinen. Hier setzt das Projekt an und widmet sich insbesondere auch den Visionen und Befürchtungen, die von der Computerisierung der Arbeitswelt ausgingen. Damit wird das durch die Forschung gut belegte Wechselverhältnis zwischen den produktionstechnischen Forschungen, der Industrie, der Forschungspolitik und Gesellschaft herausgestellt.
Die Entwicklung der PTF, deren Vorstellungen von der Fabrik der Zukunft und die Reaktionen darauf sollen mit dem Konzept des Wissenspfades beschrieben und erklärt werden. Das Projekt lehnt sich damit an das Konzept der Pfadabhängigkeit an, das in der Technikgeschichte bereits verschiedentlich fruchtbar gemacht wurde. Es soll die Herausbildung, Formung und insbesondere die Stabilität einer Forschungsrichtung erklären helfen. Generell zielt das Pfadkonzept auf die Erklärung von Kontinuität und Beständigkeit eines einmal eingeschlagenen Weges ab. Informatisierung und Computerisierung der PTF erscheinen dabei als Leitbild, das trotz Sackgassen, Umwegen und Anpassungen beibehalten wird und sich auch heute in der Idee von Industrie 4.0 wiederfindet.
Das Schwarze Gold der Industrialisierung – Eine Stoffgeschichte der Steinkohle aus Aachen, Niederschlesien und Westsachsen im 19. Jahrhundert (Dissertation)
Meine Dissertation „Das Schwarze Gold der Industrialisierung – Eine Stoffgeschichte der Steinkohle aus Aachen, Niederschlesien und Westsachsen im 19. Jahrhundert“ entstand im Rahmen des von der Fitz-Thyssen-Stiftung geförderten Forschungsprojekts „Europäische Montanregionen im Kontext der Industrialisierung“ an der Ruhr-Universität Bochum. In zwei Teilprojekten wurden Steinkohlenreviere untersucht. Während meine Kollegin Juliane Czierpka zwei Führungsregionen der Industrialisierung und ihre wirtschaftsräumliche Konstitution untersuchte, analysierte ich die Industrialisierung der peripheren deutschen Steinkohlenreviere. Bei der Suche nach den Unterschieden zwischen führenden Revieren und solchen deren Entwicklung stagnierte, stellte ich fest, dass bisherige Studien meist an der Oberfläche blieben und die Integration von Wirtschaftszweigen, die Entwicklung von industriellen Infrastrukturen oder technische Erfolge und Misserfolge untersuchten. Die stoffliche Basis blieb jedoch außen vor und so wurde der Kern des Wirtschaftens mit Steinkohle bislang bei der Analyse von Montanregionen nicht in den Blick genommen.
Meine Arbeit zeigt, wie die Materialität der Steinkohle wahrgenommen wurde und technische wie wirtschaftliche Handlungen bestimmte. Am Beispiel konkreter Steinkohlenvorkommen aus der Aachener Region, Niederschlesien und Westsachsen werden im Gegensatz zur bisherigen Forschungstradition nicht die Erfolge lokaler Unternehmungen oder regionaler Wirtschaftsbeziehungen nachgezeichnet, sondern die Steinkohle als zentrales und sinnstiftendes Material in den Mittelpunkt der Geschichte von Regionen gesetzt. Damit rückt erstmals derjenige Rohstoff in den Mittelpunkt einer stoffgeschichtlichen Analyse, der schon so oft als Motor der Industrialisierung und deren „Schwarzes Gold“ beschrieben wurde. Indem ich die verschiedenen Zugänge und kulturellen Aneignungsprozesse, die mit der Steinkohle im 19. Jahrhundert verbunden waren, untersucht habe, konnte ich zeigen, dass die Steinkohle als historische Akteurin wichtige wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Verbindungen hervorbrachte und andere verhinderte. Anhand der Fallstudien konnte ich zeigen, dass das wirtschaftliche und technische Handeln zwar von der Materialität der Steinkohle geprägt wurde, dabei aber immer auch regionalen Bewertungskontexten unterlag. Steinkohle ist nicht Steinkohle – kein Vorkommen gleicht einem anderen und die gleiche Steinkohle kann unterschiedlich bewertet werden.
Die Arbeit schließt zum Einen durch die Auswahl der Fallstudien eine Forschungslücke, da Regionen ausgewählt wurden, die als Kleinreviere des deutschen Steinkohlenbergbaus bisher keine sonderliche Aufmerksamkeit in der historischen Forschung erfahren haben. Zum Anderen wird mit dem Forschungsansatz, der das Material als konstituierendes Element der Reviere in den Mittelpunkt der Verflechtungen von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik stellt, die Stoffgeschichte als Erweiterung für die geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Bergbaurevieren vorgeschlagen. Die Suche nach Entwicklungsunterschieden von Steinkohlerevieren, so wird hier gezeigt, muss bei der Steinkohle als Materialbasis und konstitutivem Element der Regionen ansetzen.
Letzte Änderung: 9. Januar 2019